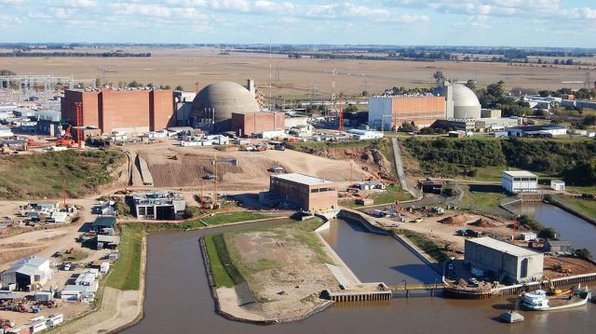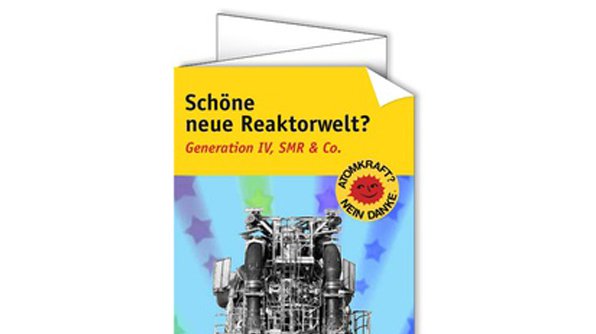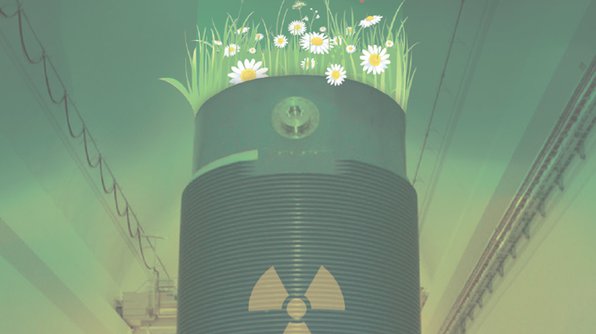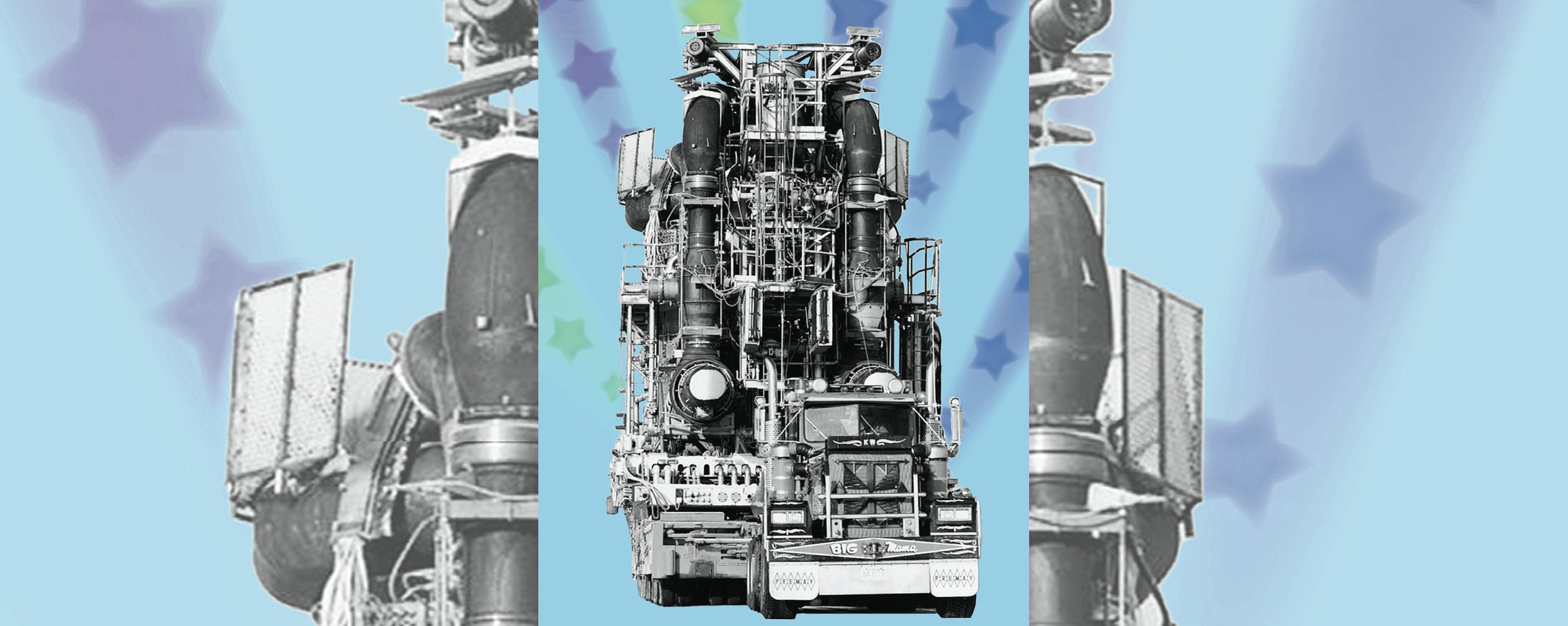
Reaktorforschung und neue Reaktoren
Sicher, sauber, billig? Mit diesen Versprechen wirbt die Atom-Lobby seit Jahrzehnten für Atomkraft – kein AKW weltweit hat sie je erfüllt. Nun soll, glaubt man den Atom-Fans, eine neue Generation von Reaktortypen angeblich alle Probleme der Atomkraft lösen: Keine Risiken, kein gefährlicher Atommüll, keine horrenden Kosten, lautet erneut das Versprechen. Und obendrein sollen die Reaktoren auch noch das Klima retten.
Neue Studie: "Analyse und Bewertung des Entwicklungsstandards, der Sicherheit und des regulatorischen Rahmens für sogenannte neuartige Reaktorkonzepte"
Das Bundesamt für nukleare Entsorgung (BASE) hat wissenschaftlich untersuchen lassen, wo die Entwicklung von sogenannten "neuen" Reaktorkonzepten zur Zeit steht.
Die Studie bestätigt, was schon lange bekannt ist. Die "neuen" Reaktoren sind und bleiben teure, unsichere Luftschlösser.
[Bei diesen Konzepten sind] weiterhin zahlreiche sicherheitstechnische und ökonomische Fragestellungen offen [...]. Sie werden bis zur Mitte dieses Jahrhunderts nicht in relevantem Umfang zum Einsatz kommen.
Trotz der Tatsache, dass die Reaktorkonzepte teils seit Jahrzehnten in Entwicklung sind, existiert bis heute kein kommerziell konkurrenzfähiges Reaktorkonzept. Der weitere Zeitbedarf für die Entwicklung [liegt] im Bereich von mehreren Jahrzehnten.
(Website BASE, 22.3.24)
Download Kurzfassung Vollständige Studie (externe Links)
Stand: 21.3.24
In Wahrheit stehen hinter dem Versuch, die Atomenergie als angebliche „Zukunftstechnologie“ umzudeuten, starke finanzielle, geopolitische und militärische Interessen. Die vermeintlich neuen Reaktor-Konzepte sind bereits im letzten Jahrhundert gescheitert, ungeachtet dessen werden sie jetzt wieder aus der Mottenkiste geholt. Selbst mit Verbesserungen hier und da kann keines dieser Konzepte die Versprechungen einlösen. Sicherheitstechnische oder technologische Durchbrüche sind nach Einschätzung von Expert*innen nicht zu erwarten. Auch die „neuen“ Reaktor-Konzepte sind gefährlich, schmutzig und teuer. Sie bringen nicht vertretbare Risiken für Mensch und Natur mit sich und die Frage des verantwortungsbewussten Umgangs mit den strahlenden Hinterlassenschaften bleibt ungeklärt. Auch für den Klimaschutz würden sie nichts bringen, schon weil sie, wenn überhaupt, viel zu spät kämen, um in nennenswertem Umfang zur Emissionsminderung beizutragen. Es gibt also auch mit Blick auf angeblich „neue“ Reaktorkonzepte keinen guten Grund, an Atomenergie festzuhalten.
Interview mit Reaktorexperte Christoph Pistner
Über Propaganda und Realität neuartiger Reaktorkonzepte und warum auch die Transmutation das Atommüllproblem nicht löst.
"Neue" Reaktortypen
FILMTIPP: TERRA-X: Mini-Kernkraftwerke: Der Weg aus der Klimakrise?
Harald Lesch erläutert in diesem Video, warum SMR kein Weg aus der Klimakrise sind.
Blog-Einträge
Link-Liste
-
Öko-Institut: Neue Reaktorkonzepte. Eine Analyse des aktuellen Forschungsstands. (04/2017)
-
Öko-Institut, TU Berlin, Physikerbüro Bremen: Sicherheitstechnische Analyse und Risikobewertung einer Anwendung von SMR-Konzepten (Small Modular Reactors) (03/2021)
-
Institut für Sicherheits- und Risikowissenschaften der Universität für Bodenkultur (Wien): Sicherheitstechnische Analyse und Risikobewertung von Konzepten zu Partitionierungs- und Transmutationsanlagen für hochradioaktive Abfälle (03/2021)
-
Taz: Energie durch Kernfusion: Für immer ein Traum? (08/2020)
-
BUND: Alte Lügen - Neu verpackt / Kleine, neue, "grüne Atomkraft" / Nuclear Pride Coalition & Klimawandel (12/2019)
-
World Nuclear Association: Generation IV Nuclear Reactors (12/2020)
-
Paul Scherrer Institut: Fortgeschrittene nukleare Systeme im Vergleich, (9/1996)